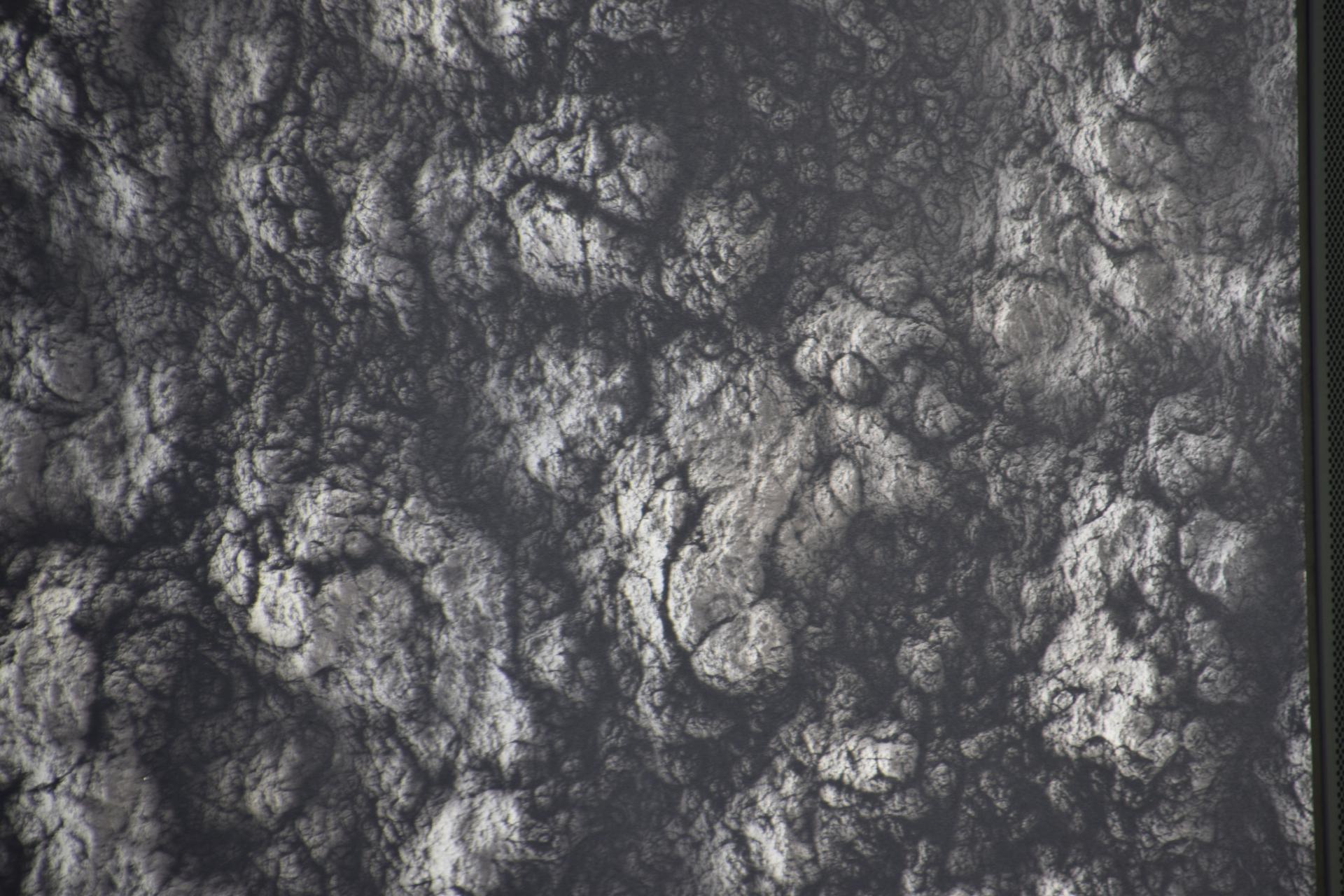Aktuelles




05.03.2024
Besuch des Baylabs in Monheim
Studierende der Qualifikationsphase haben am 05.03. das Baylab in Monheim besucht, um dort genetische Verfahren auszuprobieren.

13. Juni 2023
Toller 2. Platz im ARS-Fußballturnier
Studierende feiern Pokal zum Semesterausklang
13 Mannschaften fighteten um Sieg und Plätze. Das Team der Abendrealschule im Städtischen Weiterbildungskolleg freute sich über den hart errungenen Erfolg, knapp vorbei am obersten Siegertreppchen.

09. März 2023
Theaterbesuch des Stücks "Nathan der Weise" im Depot 1
Die Studierenden des 5. Semesters besuchten am 9. März 2023 eine Aufführung von Lessings Drama „Nathan der Weise“ im Depot 1 in Köln-Mülheim. Die Inszenierung sparte nicht mit Einfällen. Nathans Tochter Recha, die bei einem Brand beinah ums Leben gekommen wäre, erscheint gleich zu Beginn umwickelt von Verbänden. Und Al-Hafi, vom Bettelmönch zum Schatzmeister Saladins befördert, betritt die Bühne, indem er aus einem Kühlschrank klettert. Wir kennen jetzt den Weg.


25.01.2023
Winterfest
Am Mittwoch haben wir zum ersten Mal unser neues Winterfest gefeiert. Dabei sind auch unsere Abgänger mit Fachhochschulreife in einem feierlichen Rahmen verabschiedet worden. Danke an das besondere Engagement unserer Studierenden und an die herausragende Organisation unserer SV. Vielfältige Speisen aus unterschiedlichen Kulturen brachten die Studierenden mit, die bei einem leckeren Kaltgetränk und Musik verzerrt wurden.

11.01.2023
Tag der offenen Tür
Am 11.01. hat am Abendgymnasium der "Tag der offenen Tür" stattgefunden. Zahlreiche Interessierte haben sich über unsere Schule informiert. Dazu erstellten die Fachschaften im Vorfeld Materialen und Übersichten zur Information über die angebotenen Unterrichtsfächer. Die Kolleginnen und Kollegen, die Schulleitung und die Schulsozialarbeit beantworteten Fragen der künftigen Studierenden. Danach besuchten diese eine "Schnupperstunde" im Fach Deutsch, Mathematik oder Englisch. Begleitet wurde der Abend durch Snacks und Getränke.
16.12.2022
Abitur 2022
Am 16. Dezember hat das 6. Semester im Ilyo-Restaurant in Meerbusch sein Abitur gefeiert.


08.12.
Exkursion ins Baylab
Am 8.12. fuhren die Studierenden der Biologie LKs des 3., 4. und 5. Semesters sowie weitere interessierte Studierende ins Baylab, dem Schülerlabor der Bayer Crop Science in Monheim. Nach einem informativen Auftaktvortrag konnten dort die gentechnischen Verfahren PCR und Gelektrophorese in Kleingruppen praktisch und unter wissenschaftlicher Anleitung durchgeführt werden. Diese Grundlagen der Gentechnik sind unter anderem auch für das Zentralabitur verpflichtend. Das Feedback der Teilnehmer war sehr positiv und wir bedanken uns beim Baylab für diese Gelegenheit, wissenschaftliche Praxis mitzuerleben - es war bestimmt nicht der letzte Besuch des Abendgymnasiums.

10.08.2022
Wieder in der Rückertstraße!
Nachdem wir fast 3 Jahre mit unserem Abendgymnasium im Interim in der Sankt-Franziskus-Straße unterrichtet haben, sind wir endlich wieder in unserem sanierten Schulgebäude in der Rückertstraße in Rath angekommen.
Sämtliche Unterrichtsräume verfügen nun über eine hochmoderne Ausstattung, sodass dort im Unterricht digital gearbeitet werden kann.
26.07.2022
Die Sanierungsarbeiten am Gebäude sind seit August 2022 beendet.
Presse: